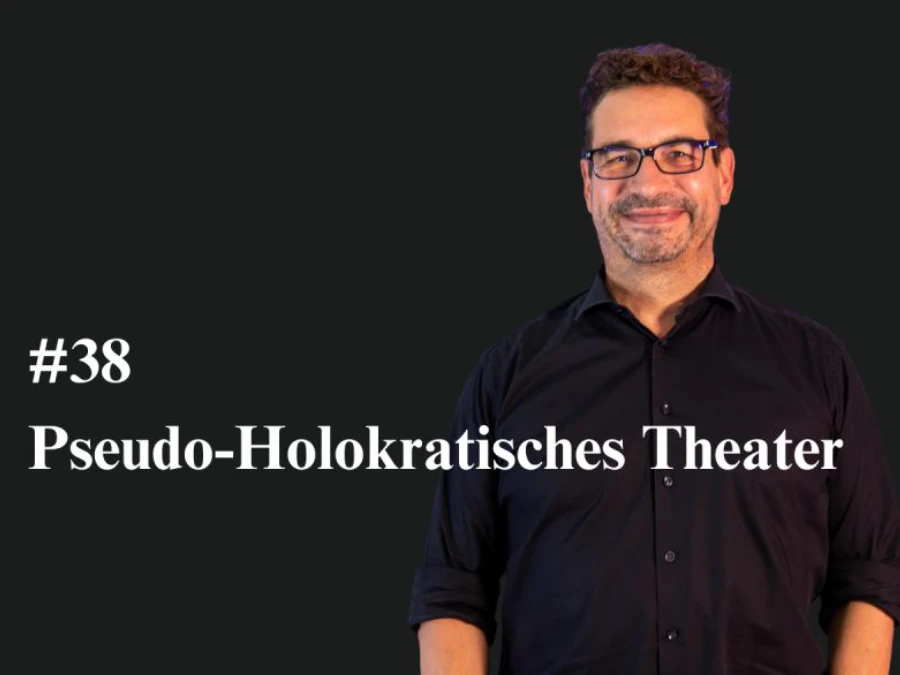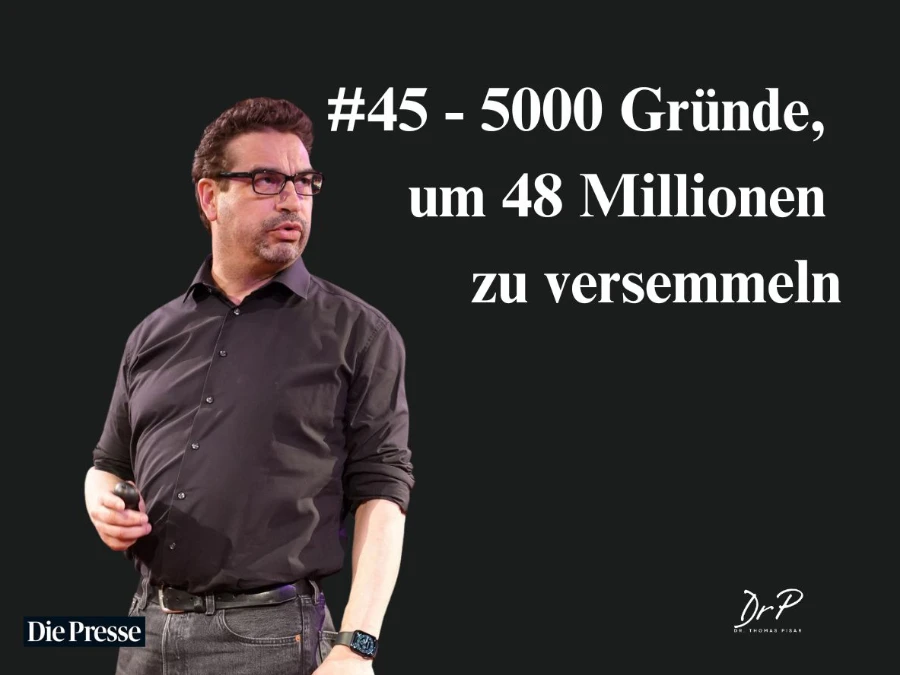Die Firma NeoOrg schmückt sich mit dem großen Etikett der Holokratie[1].
Keine Gelegenheit wird ausgelassen, das in der Kommunikation nach außen zu erwähnen. Nur Veganer reden öfter darüber, dass sie Veganer sind.
Es gibt keine Hierarchie, es gibt nur Kreise. Entscheidungen werden dort getroffen, wo die Kompetenz ist. Es gibt klare Abläufe. Die Organisation als Betriebssystem. Keine Machtspiele. Nur Transparenz, Selbstorganisation, Eigenverantwortung.
Die Website ist voll mit Buzzwords. Die Realität voll mit Bullshit.
Denn es gibt Laussucher. Laussucher ist einer der Geschäftsführer. Offiziell gleichwertiges „Kreismitglied“. Inoffiziell: Alleinherrscher und Sonnenkönig der konzentrischen Kreisverwaltung.
Laussucher trifft alle Entscheidungen, zumindest alle, die fürs Geschäft wichtig sind. Er trifft sie intuitiv und aus dem Bauch, dort, wo Entscheidungen seiner Meinung nach hingehören. Er nennt das den inneren, intuitiven Konsent[2]. Seinen Konsent, da ist er mit sich ganz im Reinen.
Wenn jemand wagt zu widersprechen, kommt der Blick. Leicht gesenkt. Dann das Schweigen. Leises Atmen durch die Nase. Nur einmal. Dann: „Ihr seid gegen mich. Alle. Ich merke das schon wieder.“
Emotionaler Terror. Perfekt inszeniert. Hat er von seiner sechsjährigen Tochter abgeschaut.
Es gibt Werte und klare Regeln in der NeoOrg. Laussucher ist Meister der Werte, wenn es darum geht, diese für seine Argumente einzusetzen. Situationselastisch. Sonst eher nicht. Dann lieber den Beleidigten spielen, wenn er nicht verstanden wird. Alles Nörgler, die da ihre sachlichen Argumente bringen wollen. Die spüren die richtige Lösung nicht.
Das Regelthema entwickelt sich großartig. Aus Sicht der Regeln. Sie werden laufend mehr, und widersprüchlicher. Alte Regeln können schwer außer Kraft gesetzt werden. Da fügt man lieber neue Ergänzungen hinzu. Das geht leichter. Weniger leicht ist es, sie ernsthaft zu befolgen, aber wer will das. Außerdem kann man die Regeln einmal so oder so auslegen, wie man es grade braucht. Laussucher nennt das agil. Er spricht von Ambiguitätstoleranz.
Laussucher stellt Leute ein, die keiner braucht. Einen befreundeten Consultant, dessen Rolle so klar ist, dass er sie selbst nicht kennt.
Eine „Rollenexpertin für Resonanzräume“. Keiner weiß, was das ist, nur, was sie kostet. Das Gehalt resoniert weniger bei den anderen. Sie ist die Schwägerin der Zahnarzthelferin, weil er einen früheren Termin für die Zahnspange seines Sohnes braucht.
Wenn jemand vorsichtig anmerkt, ob die alle wirklich notwendig seien, kommt die Antwort: „Das ist doch das Wesen der Holokratie: Jeder darf seinen Platz finden.“
In der Zwischenzeit tagen die Kreise in ihrer natürlichen geometrischen Form: im Kreis mit konstantem Radius. Keine Annäherung an einen Punkt zu erkennen. Stundenlanges Gerede über Transparenz, Rollenklärung, Konsententscheidungen. Flipcharts voll mit Pfeilen, Post-its in allen Formen und Farben. Entscheidungsgrundlagen werden vorbereitet, abgestimmt und in vielen Iterationen verfeinert. Abende für zusätzliche Abstimmungen geopfert.
Wichtige Entscheidungen wie die Häufigkeit, in der die Fenster geputzt werden sollen, werden genauso lang diskutiert, wie der Einstieg in ein neues, innovatives Geschäftsfeld. Workshop, Konsent, nächste Iteration. Vier Wochen Diskussion. Mehr Slides als es Fenster im Büro zu putzen gibt.
Es dürfen immer alle mitdiskutieren: von der Reinigungskraft bis zum Geschäftsführer. Die Erstere hat beim Thema Fensterputzen Kompetenz, dem Letzteren wird diese in beiden Fällen abgesprochen.
Die tatsächlich wichtigen Geschäftsentscheidungen werden bis zum einsetzenden Schwindel diskutiert, und dann „im Nachgang“ am Gang von Laussucher mit den verbleibenden, ihm zustimmenden Personen alternativ interpretiert. Jenen zwei, die sich jeden Morgen mit „Popolan“ einschmieren, um leichter eine Runde im Allerwertesten von Laussucher drehen zu können. Entscheidungen außerhalb des zuständigen Kreises. Im Metakreis des Sonnenkönigs. Alles im Geiste der Holokratie. Fast schon wie in einem Konzern.
Die Mitarbeitenden glauben an die große Idee sich selbst einbringen zu können, Verantwortung zu übernehmen, sich zu engagieren. Es werden viele Überstunden geleistet, nicht alle werden aufgezeichnet. Zumindest war das mal so.
Politik, dürftige Erklärungen auf kritische Rückfragen, emotionale Diskussionen als Folge von sachlichem Widerspruch, all das führt dazu, dass selbst der letzte Idealist der ersten Stunde versteht, wie der Hase läuft und resigniert.
Laussucher sieht sich als Visionär. Weiterhin. Ein Visionär wird nicht immer von allen verstanden.
Die anderen sehen die Lage, wie sie ist: Alle sind gleich. Nur Laussucher, der ist gleicher.
[1] Holokratie ist ein Organisationsmodell, das auf Selbstorganisation, dezentralen Entscheidungen und klaren Rollen basiert. Anstelle einer klassischen Hierarchie gibt es sogenannte Kreise, in denen Zuständigkeiten definiert sind. Entscheidungen sollen dort getroffen werden, wo das meiste Wissen vorhanden ist. Ziel ist mehr Transparenz, Anpassungsfähigkeit und Eigenverantwortung in der Organisation.
[2] Ein Konsens ist, wenn alle dafür sind. Ein Konsent, wenn niemand ernsthaft dagegen ist. Der Unterschied ist subtil. Beim Konsens wird geredet, bis alle nicken. Beim Konsent, bis keiner mehr den Kopf schüttelt. Dauert meist beides gleich lang, nur das beim Konsent am Ende der Chef entscheidet.
Learnings
Die Geschichte hat keinen realen Hintergrund. Holokratie steht hier stellvertretend für alle möglichen Modelle über deren Qualitäten ich nichts aussagen kann. Was können wir daraus generell lernen:
- Es ist egal wie das Ding heißt, Holokratie, Agile, BetaCodex, Soziokratie, etc.: Wenn die Macht an einer Stelle liegt, dann darf man zwar in schön moderierten Meetings mitreden, aber man sitzt nicht am Tisch, wenn entschieden wird. Im Gegenteil, die Möglichkeit der Benennung des Modells macht es noch leichter, da man der Fassade, hinter der man sich versteckt, einen Namen geben kann. Der Frust und die Resignation entstehen nicht aus harter Arbeit, sondern aus der Diskrepanz zwischen Kommunikation, Erwartungshaltung und erlebter Wirklichkeit.
- Ein Modell ist ein gedachtes Wunschbild, das so in der Realität nicht vorkommt. Erst die Realisierung des Modells in der Wirklichkeit zeigt, wie gut die Dinge im konkreten Kontext funktionieren. Damit will ich nicht sagen, dass Modelle schlecht sind. Ich zitiere lieber George Box: „Alle Modelle sind falsch. Einige sind nützlich“.
- Modelle unhinterfragt anzuwenden ist höchst kritisch, weil der Kontext darüber entscheidet, was passt und was nicht. Modelle zu verwenden, um Dinge besser einordnen zu können, quasi als Landkarte, kann hilfreich sein.
- Ein Framework dagegen ist offener. Es besteht aus Prinzipien, Heuristiken, Empfehlungen, die man dann bewusst im eigenen Kontext anwendet. Das eine ist entweder eine Blaupause (dann Obacht) oder eine Landkarte, das andere ein Werkzeugkasten.
- Modelle führen leicht in Versuchung, zu glauben, etwas verstanden zu haben. Menschen, deren Zeit sehr eng getaktet ist (also Manager), sind dafür besonders anfällig. Das beim Verstehen ausgeschüttete Dopiman lässt einen darüber hinwegsehen, ob das Ding an sich überhaupt passt.
- Ein Modell als Geschäftsführer für einen Etikettenschwindel zu verwenden, führt zu Resignation und einem toxischen Klima. Lediglich die Ja-Sager und Mitläufer bleiben einem treu erhalten. Alles Gute mit der C-Mannschaft.
- Die Anzahl der Buzzwords nach außen, kann ein guter Indikator für den Bullshit nach innen sein.
- Ein Workshop allein ist noch kein Indiz für Partizipation. Die Möglichkeit der Beteiligung gepaart mit der konsequenten und transparenten Umsetzung nach dem Workshop machen den Unterschied. Wie oft erleben wir aufgeblasene Strategieklausuren mit viel Glitter und Flitter und einer beeindruckenden Maßnahmenliste, die in Folge schneller in einer Sharepoint-Rundablage landet, als man das letzte Nuggatwürferl von der Klausur verdaut hat.
Nur, was umgesetzt wird, zählt. - Eine klare Hierarchie ist einem Pseudo-Was-Auch-Immer vorzuziehen.
Es ist erstaunlich, welche dysfunktionalen Kulturen in Organisationen herrschen können, ohne dass diese am Markt ausselektiert werden. Umgekehrt stellt sich die Frage, um wie viel mehr Erfolg mit einer alternativen Kultur möglich wäre. Welches Potenzial bleibt hier auf der Straße?
Kennen Sie ähnliche potemkinsche Dörfer, die in Organisationen aufgebaut und missbräuchlich verwendet werden? Kennen Sie Organisationen, in denen die Diskrepanz zwischen Außendarstellung und Innenleben nur mehr als „diametral verschieden“ bezeichnet werden kann? Arbeiten Sie vielleicht selbst in einem ähnlichen Umfeld und wie geht es Ihnen damit?
Artikel erschienen am 01.10.2025 in der „Presse„: https://www.diepresse.com/20148849/bier-zahlen-downsizing